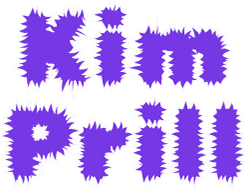Noisepollution ist längst ein politisch diskutiertes Thema – doch konkrete Maßnahmen verlaufen oft schleppend oder scheitern an hohen Kosten. Zur Datenerhebung und politischen Argumentation testet das Fraunhofer-Institut akustische Sensorik für Echtzeit-Audioanalysen im städtischen Raum. Das Projekt Noisepass denkt diese Entwicklung weiter:
In einer idealen Zukunft greift die Anwendung auf diese Daten zurück und ermöglicht Nutzer*innen, lärmintensiven Routen auszuweichen und ihre Umgebung neu zu entdecken.
Zum Projektstart habe ich zunächst theoretisch und empirisch untersucht, wie stark Noise Pollution tatsächlich als Belastung empfunden wird. Dafür konzipierte ich eine Umfrage zum Thema Lärmbelastung und befragte überwiegend Teilnehmende in Hamburg zu ihren alltäglichen Erfahrungen mit Umgebungslärm. Insgesamt nahmen 159 Personen teil.
Die theoretische Auseinandersetzung zeigte deutlich: Es gibt eine Vielzahl an Studien, die die gesundheitlichen Auswirkungen von Lärm belegen. Basierend auf diesen Erkenntnissen entwickelte ich mithilfe der Double Diamond Methodik einen Projektplan, der mögliche Lösungsansätze im Kontext der identifizierten Problematik aufzeigt. Die angewendeten Designmethoden sind im unteren Bereich dargestellt.
Die Anwendung der Methodik „Opportunity Solution Tree“ lieferte verschiedene Lösungsansätze, die als eigenständige Features im digitalen Produkt umgesetzt werden könnten. Auf dieser Basis entschied ich mich für die Entwicklung einer mobilen Applikation.
Aus meiner Sicht bietet das Smartphone die passenden technischen Voraussetzungen und einen alltagstauglichen Rahmen für das Nutzungsszenario. In einem ersten Systemüberblick habe ich alle geplanten Features zusammengeführt. Dabei werden auch ihre Abhängigkeiten sichtbar und lassen sich im inhaltlichen Zusammenhang betrachten.
Vom Wireframing bis zur Erstellung des ersten Prototyps stand für mich die Usability im Fokus – und damit verbunden auch die Berücksichtigung von Accessibility. Im Designprozess habe ich gezielt Parameter eingebunden, die die Nutzerfreundlichkeit fördern, darunter die Einhaltung klar definierter Content-Bereiche, visuelle Hierarchien, kontrastreiche Farben und unterstützende Formgebung.
Im Kurs erhielt ich den Hinweis, bestehende Design-Systeme mit Accessibility Guidelines zu analysieren. Daraufhin entwickelte ich ein eigenes, vorläufiges Designsystem, das als Grundlage für den ersten High-Fidelity-Prototyp diente.